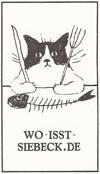Als vor fast einem Vierteljahrhundert die Mauer fiel, als die unerwartete Wende das Leben aller Deutschen veränderte, hielten wir Wunder für möglich. Man versprach uns blühende Landschaften, was wir mit der in Westdeutschland erreichten gastronomischen Blüte gleichsetzten. Das war ein Fehler, denn die Bedürfnisse der befreiten Brüder und Schwestern richteten sich keineswegs auf eine Verbesserung ihrer Suppen, als vielmehr auf nützliche Dinge, zu wessen Nutzen sie auch produziert sein mochten.
Als vor fast einem Vierteljahrhundert die Mauer fiel, als die unerwartete Wende das Leben aller Deutschen veränderte, hielten wir Wunder für möglich. Man versprach uns blühende Landschaften, was wir mit der in Westdeutschland erreichten gastronomischen Blüte gleichsetzten. Das war ein Fehler, denn die Bedürfnisse der befreiten Brüder und Schwestern richteten sich keineswegs auf eine Verbesserung ihrer Suppen, als vielmehr auf nützliche Dinge, zu wessen Nutzen sie auch produziert sein mochten.
Jedenfalls waren es nicht die Feinschmecker, die in erster Linie von der Privatisierung der Gastronomie profitierten. Auch in zweiter Linie nicht. Erst nach ungefähr zwanzig Jahren setzte zaghaft ein, was in den westlichern Provinzen der Stolz ganzer Regionen ist: es entstanden international anerkannte Gourmet-Restaurants der Oberklasse.
Das Wort ‚zaghaft‘ illustriert präzise die nicht mehr so neue Situation. Es keimt eigentlich überall, aber zur prächtigen Blüte reicht es nicht. Berlin ist das beste Beispiel. Unsere Metropole ist in aller Welt beliebt, zieht entsprechend viele Besucher an, hat prächtige Luxushotels und nicht wenige elegante Restaurants. Aber zu drei Michelinsternen hat es bisher nicht gereicht.
Das muss verwundern, da wir doch auf der Skala der besten europäischen Restaurants einen stolzen zweiten Platz (nach Frankreich) besetzen.
Aber Berlin und die angeschlossenen Ostgebiete verweigern die notwendigen Spitzenleistungen. Nach über zwanzig Jahren der Eingliederung in unser westliches Konsummilieu, wäre es nicht verwunderlich, wenn die Menschen jenseits der Elbe nicht nur die gleichen Autos führen wie wir auf der westlichen Seite (was sie brav tun), sondern auch unsere gastronomischen Ansprüche übernommen hätten. Aber davon kann keine Rede sein.
Nach wie vor kann man in ungewohnter Bequemlichkeit über die neuen, dreispurigen Autobahnen fahren, ohne das Gefühl zu haben, rechts und links ein paar erstklassige Gasthäuser zu verpassen oder gar eine jener Adressen, die jeder Feinschmecker auf der Wunschliste seiner Sehnsüchte stehen hat.
Auch der soeben erschienene Michelin 2014 ändert daran nichts Wesentliches. Eine hartnäckige Armut kann es nicht sein. Dazu hat uns Frau Merkel zu oft versichert, dass wir (wir Gesamtdeutsche) mit unserem Wohlstand ein beneidetes Vorbild in ganz Europa seien.
Haben also die Investoren – die überall gebraucht werden, wo neue Wohnblocks, neue Industrien und neue Betonhalden entstehen – haben diese Spürnasen des kommenden Wohlstands eine schlechte Witterung in den Esszimmern und Kantinen der neuen Länder registriert? Etwa eine puritanische Genussfeindlichkeit? Oder sind sie gar von ideologischer Sturheit befallen, wonach einem Land, das einmal kommunistisch geprägt war, nie mehr zu trauen sei?
Dem widerspräche das Beispiel der hoch gelobten Gastronomie Westdeutschlands, welche sich überwiegend aus kleinen Familienbetrieben entwickelt hat, mithin durch private Anstrengung erfolgreich wurde.
Oder existiert tatsächlich der in Familien nicht seltene Vorbehalt gegenüber einem Verwandtschaftszweig („Tante Gusti und ihre Mischpoke sind doch halbe Zigeuner“), der für alles Fremdartige eine ebenso ungerechtfertigte wie gehässige Begründung abgibt?
In unserem Fall wäre das dann die Gleichsetzung Preußens mit Sibirien einschließlich der daraus folgenden Anspruchslosigkeit in Sachen des guten Geschmacks. Also ein deutsches Erzübel.
Das wäre die schlimmste aller Erklärungen für einen Mangel, der in den Augen der meistens gar nicht erkennbar ist. Aber diese Kolumne richtet sich bekanntlich nicht an die meisten, sondern an die wenigen, für die die Lebensweise ihres Volkes ein Politikum ist.
Meine letzten Recherchen im gastronomischen Osten vor ungefähr einem Jahr führten mich nach Sachsen, wo ich die unterschiedlichsten Betriebe kennen lernte. Jetzt bin ich wieder in Dresden, was hier „liebevoll“ als Elbflorenz bezeichnet wird. Wie sie den Arno mit der Elbe verwechseln können und die Renaissance mit dem Barock, ist mir nicht klar geworden. Aber was besagt das schon. Ob Lorenzo di Medici oder August der Starke, ob Uffizien oder das Grüne Gewölbe, die Manager des Tourismus‘ beglückwünschen sich zu den Schatzkammern, die in beiden Gebäuden installiert sind. Ich kann nur den Florentinern dazu gratulierenen, dass sie Savonarola, den Verkünder der Bescheidenheit, verbrannt haben. Hier in Dresden ist zwar mehr verbrannt, darunter sehr viel barocker Protz, aber die Bescheidenheit hat überlebt. Echt preußisch eben.
Das wird deutlich an der einzigen Adresse der populären Stadt an der Elbe, die einen Michelinstern vorweisen kann, „Bean&Beluga“. Wir waren an einem Donnerstag Abend dort und die einzigen Gäste. Das lag, wie wir vermuteten, nicht an technischen Mängeln der Köche (obwohl die Konsequenz, mit der die minimalistischen Hauptprodukte auf den Tellern bis zur Unkenntlichkeit verfremdet wurden, durchaus abschreckend wirken kann), sondern eher an einer stilistisch fragwürdigen Eigenart dieses Gourmet-Lokals: es ist durchgehend schwarz angestrichen. Außerdem ist der Speiseraum ein schmaler Schlauch, so dass man sich vorkommt wie im Tunnel unter dem Ärmelkanal; nur der Service isr, zugegebenermaßen, ein bißchen langsamer als ein ICE. Ein extravagantes Auswahlprinzip bei der Speisekarte erleichtert dem Gast die Wahl keineswegs. So genügt die angewandte Originalität bei der Konstruktion der Miniportionen noch lange nicht, den Wunsch nach einer Wiederkehr zu wecken.
Im Augustiner an der Frauenkirche, einem Ableger der Münchener Brauerei, sucht man erst gar nicht nach Erklärungen, weder für die gute Laune der lärmenden Gäste, noch für das gigantische Ausmaß eines Germknödels mit Portweinpflaumen. Überhaupt kann von Zeit zu Zeit ein Besuch in einer dieser populären Gaststätten nicht schaden, damit sich Feinschmecker ein Bild machen können von den ungeheuren Mengen an extrem nahrhaften Lebensmitteln, die sich deutsche Verbraucher nicht nur in Dresden einverleiben. Wobei nicht verschwiegen werden soll, dass der konfektionierte Billigfraß in innerstädtischen Gaststätten längst nicht mehr so hundsgemein schmeckt wie noch vor zwanzig Jahren. Das ist jedoch kein Etappensieg der Kochkünstler, sondern verrät nur die enge Zusammenarbeit der Gastronomie mit den deutschen Aromafabriken, die zu den erfolgreichsten der Welt gehören.
Wieviel fröhlicher schlägt das Herz des Wandersmanns, wenn er ein Rasthaus findet, in dessen Küchen gearbeitet wird, wie es sich der grüne Naturfex erhofft, nämlich nur mit regionalen Produkten, tierfreundlich und der Jahreszeit gemäß, wo ein eigener Gemüse- und Kräutergarten garantiert, dass gentechnisch veränderte Pflanzen keinen Zutritt haben und sogar auf der Weinkarte bio-dynamisch produzierte Weine in der Mehrzahl sind. Schließlich ist es in solchen Betrieben nicht ungewöhnlich, dass das im Ofen schmorende Tier einen Kosenamen bei jenen hatte, die gerade dabei sind, seine Einzelteile in schmackhafte Portionsstücke zu verwandeln.
So einen Saftladen fand ich bei meiner letzten Reise in Hartmannsdorf bei Chemnitz mit dem programmatischen Namen „Laurus-Vital. Ich war jetzt mehr als neugierig: Was mochte aus ihm geworden sein? Hatte er einem Computerladen weichen müssen? Oder einem Billig-laden mit chinesischem Kinderspielzeit?
Was ich sah, grenzte an ein Wunder: Bunte Fahnen kündeten das Restaurant von weitem an; dieselben Leute von einst werkelten in der Küche, der Essraum war vergrößert, eine angegliederte Kochschule unterrichtete Gäste im richtigen Umgang mit der essbaren Natur. (Tel 03722-505.210; Limbacher Str. 129, 09232)
Das Laurus Vital ist eine Erfolgsmeldung, wie sie in unserer Zeit noch selten ist, deshalb aber um so erfreulicher.
Erfreulich war auch eine Initiative des Landes Sachsen für eine umfassende Dokumentation im Dresdner Stadtarchiv zum Thema Die Hofküche um 1900. Der Historiker Professor Josef Matzerath hatte sie mit seinen akademischen Gehilfen mit bewundernswerter Gründlichkeit zusammengetragen, so dass das geballte Wissen über die Hofküche des letzten Königs der Sachen drei prächtige Bände füllte (Thorbecke Verlag), deren wissenschaftlicher und kulinarischer Wert einmalig ist.
 Ach, so schlimm wird’s schon nicht werden,“ sagte der Busfahrer und zertrat den Rest seiner Zigarette. Dann erst kletterte er in sein Dienstfahrzeug und verstaute die Zettel, welche unsere Fahrberechtigung dokumentierten, in der Tiefe unter uns, nicht ohne 80 Euro kassiert zu haben zu haben. Meine, an dieser Stelle wohl tausend Mal gemachte Bemerkung „Das ist aber teuer“, entgegnete er routiniert mit: „Is ja auch für Hin- und Rückfahrt. Und das mitten in der Nacht!“
Ach, so schlimm wird’s schon nicht werden,“ sagte der Busfahrer und zertrat den Rest seiner Zigarette. Dann erst kletterte er in sein Dienstfahrzeug und verstaute die Zettel, welche unsere Fahrberechtigung dokumentierten, in der Tiefe unter uns, nicht ohne 80 Euro kassiert zu haben zu haben. Meine, an dieser Stelle wohl tausend Mal gemachte Bemerkung „Das ist aber teuer“, entgegnete er routiniert mit: „Is ja auch für Hin- und Rückfahrt. Und das mitten in der Nacht!“