 Kurz nach Überfahren der österreichischen Grenze – hier respektvoll Staatsgrenze genannt – stellt man mit Genugtuung fest, dass eine allgemeine Geschwindigkeitsbegrenzung von 130 km/h gilt, die alle Österreicher um 15 Prozent überschreiten.
Kurz nach Überfahren der österreichischen Grenze – hier respektvoll Staatsgrenze genannt – stellt man mit Genugtuung fest, dass eine allgemeine Geschwindigkeitsbegrenzung von 130 km/h gilt, die alle Österreicher um 15 Prozent überschreiten.
Auch sonst ist es ein verlässliches Völkchen, deren scheinbar nur geringe Einwohnerzahl (8,7 Millionen) man mit der Höhe der Alpengipfel multiplizieren muss, welche man wiederum um 15 Prozent zu überschreiten nicht zögern sollte, um die wahre Größe dieses gastfreundlichen Landes zu ermessen.
Für viele Deutsche entspricht diese Größe dem Umfang des Wiener Schnitzels, dem nachzueifern bisher nur Mercedes Benz mit seiner Oberklasse gelungen ist, mögen auch tausend Berliner Wirte stolz behaupten, ein essbares Wiener Schnitzel auf ihren Speisekarten anzubieten.
Doch hier soll nicht von Berliner Attraktionen die Rede sein, sondern von den gastronomischen Vorzügen Österreichs. Dazu ist es nicht nötig, die Alpenpisten mit dem Gipfelzubehör zu multiplizieren; ein Blick auf die Landkarte genügt: von Westen nach Osten ist ein lausig langes Stück zu bewältigen, zwar nicht ganz so lang wie das Stück von der amerikanischen Ost- zur Westküste. Dafür aber unendlich viel ergiebiger.
Ihren kulinarischen Reichtum verdankt die Alpenrepublik dem gekochten Rindfleisch sowie der französischen Nouvelle Cuisine, wie sie auch ihre Kaffeekultur den Türken verdankt. Was aber nicht bedeutet, auf ihrem Mist sei nichts Eigenes gewachsen. Da ist der Tiroler Speck, mit dem Schweizer Messer in dicke Stücke geschnitten, der Uhudler, das Mittel gegen Heimweh, und Rudi Bayr.
Die Rolle dieses tapferen Schöngeistes für die gastronomische Entwicklung seiner Heimat, kann man gar nicht hoch genug einschätzen. Als ich ihn kennen lernte war er Intendant des Salzburger Rundfunk und residierte in dem modernistischen Bau des ORF, von wo aus er seine segensreiche Tätigkeit ausübte, indem er das für den Rundfunk gebaute Haus in ein Weinbeisl umfunktionierte. Zum ORF-Anekdotenschatz gehört noch heute seine Bestellung für die vielen Kühlschränke, die er brauchte, um in allen Redaktionen Wein und Champagner griff- und trinkbereit vorzufinden.
Das war am Anfang der siebziger Jahre, und – wie man weiß – der Anfang von allem, was bei uns und in den Alpenländern mit der Feinschmeckerei zu tun hatte. Rudolf Bayr war ein Dichter und Ästhet, dem die traditionelle Jankermode zu üblich war, also kleidete er sich zwar auch in Salzburger Folklore, vermied aber jede Ähnlichkeit mit den teuren Gewändern, wie sie die Deutschen Herrschaften zu den Festspielzeiten bei Lanz einkaufen. Stattdessen beschäftigte er einen Leibschneider, der alles tat, um dem Intendanten nicht der Lächerlichkeit preiszugeben, ohne ihm aber das Flair eines Exzentrikers zu nehmen, als der er deutlich zu erkennen war, wenn er maßgekleidet mit uns über die Salzburger Märkte streifte.
Rudi Bayr legte bei mir den Grundstein für meine Beuschelsucht, die mich immer befällt, sobald ich die 1000 Höhenmetermarke überschreite, er machte uns auf verschiedene Buttersorten aufmerksam, die ihre Herkunft kleinen Manufakturen verdankten, und ruhte nicht, bevor er mich nicht bis zur Wachau geschleppt und mit den damals schon bemerkenswerten Weinen und ihren Produzenten bekannt gemacht hatte. Also picknickten wir mit dem alten Jamek auf seinem Ried Klaus, aßen die köstlichen Deftigkeiten im Restaurant der Familie Knoll und nahmen an einem Tanzabend der Wein-Veteranen teil, die ihren alten Tanzlehrer mit einem alten Koffergrammophon speziell engagiert hatten, um nach drei Jahrzehnten ihre Fähigkeiten im Slow-Fox zu testen.
Rudolf Bayr schaffte es, uns in wenigen Sommern die anhaltende Beliebtheit Österreichs verstehen zu lernen, die damals noch nicht von Urlaubern in Bussen geprägt war, sondern von Ferienreisenden, welche darüber staunten, in einfachen Gasthäusern aus so edlen Weingläsern trinken zu können. Das Riedel-Zeitalter hatte begonnen.


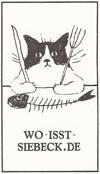

Nach einer Fernsehempfehlung von Herrn Bayr Anfang der 80-er Jahre besuchte ich in Salzburg die unprätentiöse, fast schon unscheinbare Konditorei von Herwig Ratzka in der Imbergstraße – herrliche Kuchen und Torten mit unglaublicher Sorgfalt hergestellt, Geschmack und Genuss wie man sich das besser nicht wünschen kann.
Dort gibt es heute noch eine „Rudolfstorte“ – ich hoffe, das ist eine Reminizenz an diesen sympathischen Grandseigneur der österreichischen Küche, der heute noch im österreichischen Gault-Millau als „Feinschmecker des Jahres 1984“ (der erste der diesen „Titel“ trug) geführt wird.
Großer Siebeck – danke, dass Sie solche Menschen in Erinnerung rufen !!